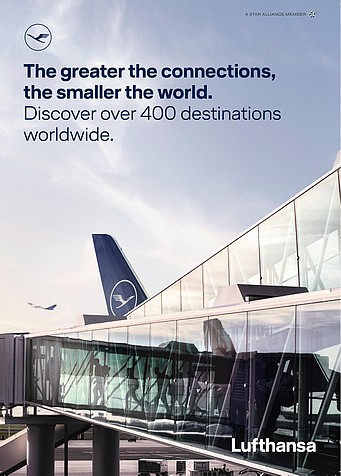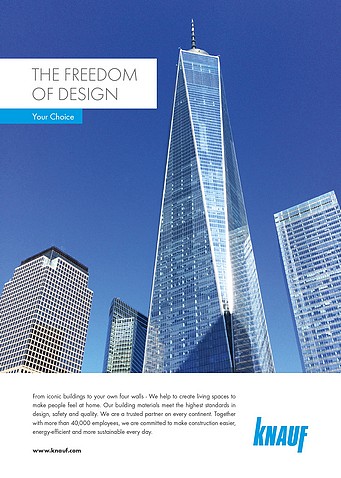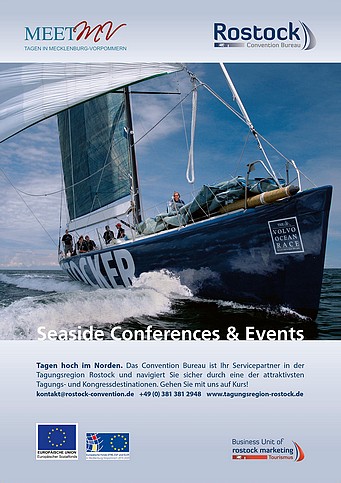Klangräume jenseits des Mainstreams – Musikfest Berlin 2025
Von Svetlana Alexeeva
Das Musikfest Berlin eröffnet nach der Sommerpause traditionell die Konzertsaison der Hauptstadt und zieht jedes Jahr Musikliebhaber in seinen Bann. Kein Wunder: Spitzenensembles aus Europa, Asien und Amerika geben sich hier die Ehre. Klassischer Kanon und zeitgenössische Musik stehen gleichberechtigt nebeneinander. Veranstaltet von den Berliner Festspielen in Kooperation mit der Stiftung Berliner Philharmoniker, überzeugt das Festival mit einer stilistischen und klanglichen Vielfalt, die in dieser Dichte und Professionalität nur selten zu erleben ist.
Französische Leichtigkeit in vollendeter Form: Orchestre de Paris
Das Festival erwies sich auch in diesem Jahr als lebendiges Forum für musikalische Vielfalt und individuelle Handschriften. Die Eröffnung gestaltete – fast schon traditionsgemäß – das Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam. Unter der Leitung von Klaus Mäkelä präsentierte sich das Spitzenorchester mit makelloser Präzision, die mancher Zuhörer beinahe museal empfand. Einen Kontrastpunkt dazu setzte das Orchestre de Paris. Unter Esa-Pekka Salonen überzeugte Frankreichs führendes Sinfonieorchester mit Lebendigkeit und schimmernder Farbigkeit und hob sich damit wohltuend vom kontrollierten Zugriff der Niederländer ab.
Salonen, 1958 in Finnland geboren, blickt auf eine beeindruckende Vita zurück. Der Ehrendirigent des Los Angeles Philharmonic ist nicht nur Dirigent, sondern auch ausgebildeter Hornist und Komponist, der avantgardistische Techniken in sein kompositorisches Schaffen integriert. Dem berühmten Satz Robert Schumanns folgend – „Der Klang des Horns ist die Seele des Orchesters“ – komponierte Salonen eigens für Stefan Dohr, Solo-Hornisten der Berliner Philharmoniker, ein Hornkonzert, das beim Musikfest seine Deutschlandpremiere feierte. Virtuos und technisch makellos entfaltete Dohr die ganze Klangpalette dieses besonderen Instruments. Sein Horn belohnte das Publikum mit einer immensen Klangvielfalt und kraftvollen Signalen, warm, atmend und voluminös vorgetragen.

Jean Sibelius' 5. Sinfonie (1915), ein Auftragswerk der finnischen Regierung zum 50. Geburtstag des damals bereits international gefeierten Komponisten, erlebte unter Salonens Leitung eine Deutung von herber Poesie. Diese Musik sei etwas komplett Anderes, weit weg vom Mainstream, so Salonen. Das ist wahr: Die Fünfte ist eigenwillig, zwiespältig, rätselhaft, auf sonderbare Weise modern. Schon der zweite Satz ist eine in sich ruhende, träumerische Variationenszene. Doch der dritte Satz ist eine Überraschung. Das berühmte „Schwanenthema“, das Sibelius nach eigenen Worten als eine Gabe Gottes beim Anblick über den See langsam ziehender Schwäne einfiel, stieg unter Salonens Hände Führung wie ein Bild auf – zart, melancholisch, von leiser Kraft durchzogen.
Eindringlich kontrastierte dazu Luciano Berios Requies für Kammerorchester (1983), eine Hommage an Cathy Berberian, Ikone der experimentellen Vokalmusik und einst Berios Ehefrau. Wie viele Werke Berios, einer Schlüsselfigur der italienischen Nachkriegsavantgarde, gleicht auch Requies einer musikalischen Collage, in der Kunst- und Volksmusik, Jazz und afrikanische Rhythmen ineinanderfließen. Das auf Kammermusik reduzierte Orchestre de Paris fand hier zu seiner Bestform. Unter Salonen, der sich bei dem Werk als feinsinniger Klangarchitekt erwies, entfaltete das Ensemble eine eindrucksvolle Transparenz. Mit kreativer Klarheit und Leichtigkeit gestaltete er Übergänge und Schichtungen, wodurch sich einmal mehr die enorme Bandbreite seines musikalischen Könnens offenbarte.
Kontraste zwischen Rokoko und Farce: Das DSO unter Anja Bihlmaier
Das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin unter der Leitung von Anja Bihlmaier nahm seine Zuhörer gleich auf mehrere Abenteuer mit. Der programmatische Bogen reichte von Tschaikowskys Rokoko-Variationen bis zu der avantgardistischen Klangwelt Bernd Alois Zimmermanns. Bihlmaier, eine der wenigen Dirigentinnen in dieser immer noch von Männern dominierten Musikdisziplin, führte mit Präzision und Gestaltungskraft durch den Abend.

Tschaikowskys Variationen über ein Rokoko-Thema A-Dur (1877) wirkten wie ein nostalgischer Blick in die prachtvolle Welt des 18. Jahrhunderts, gespiegelt durch die romantische Klangsprache des späten 19. Jahrhunderts, in dem der russische Komponist wirkte. Der junge Cellist Kian Soltani übernahm den Solopart mit makelloser Technik und bemerkenswerter Sensibilität. Sein Spiel wirkte zugleich organisch und athletisch: Den Kopf bisweilen schwelgerisch in den Nacken gelegt, die Augen hellwach und fokussiert – als entginge ihm kein Detail. Mit innerer Spannung formte er eine Solostimme, die leuchtete und erzählte. Im Dialog mit dem Orchester, fein ausbalanciert von Bihlmaier am Pult, entstand so ein Zusammenspiel von seltener Klarheit und Lebendigkeit.
In scharfem Kontrast zu Tschaikowskys Rokoko-Klangwelt stand Bernd Alois Zimmermanns sarkastische Ballettmusik Musique pour les soupers du Roi Ubu (1968). Bihlmaier selbst führte das Publikum von der Bühne aus in das Werk ein – kenntnisreicher und prägnanter hätte man dieses Schlüsselwerk der Nachkriegsavantgarde kaum vorstellen können. Schon die ersten Takte offenbaren Zimmermanns Lust am Experiment, gespeist aus seiner Idee der „Kugelgestalt der Zeit“, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft simultan erscheinen. Zitate, Stilbrüche, Überlagerungen: das eine bricht unvermittelt ins andere hinein. Es entsteht eine farbenfrohe Collage von parodistischem, bisweilen groteskem Unterton, die sich jeder traditionellen Form verweigert. Bihlmaier hielt diese fragile Struktur mit sicherer Hand zusammen. Wo das Satirische zur Fratze zu kippen drohte, bewahrte sie Maß und Linie. Das DSO antwortete mit klanglicher Fantasie und präzisem Gespür für die Theatralik des Moments – genau jene Mischung, die Zimmermanns Partitur verlangt.
Ausblick auf Kommendes
Rund 25 Tage lang war das Musikfest Berlin erneut ein Labor für neue Klänge und Forum für innovative künstlerische Arbeit. Das Programm verband Raritäten, klassische und zeitgenössische Werke zu einem Panorama größter klanglicher Vielfalt: 33 Konzerte, 122 Werke von rund 70 Komponistinnen und Komponisten. Bei dieser Fülle blieb die Auswahl selbst für eingefleischte Musikfest-Liebhaber eine Qual. Dennoch fanden fast 50.000 Menschen den Weg in die Philharmonie, den Kammermusiksaal und ins Konzerthaus. Die Zahlen sprechen für sich – und für die Strahlkraft des Festivals.
Alles im Detail zu erfassen, wäre vermessen. Jedes dieser Spitzenensembles verdiente eine eigene Würdigung. Die hier vorgestellten Aufführungen sollen daher vor allem eines: Vorfreude auf das nächste Musikfest Berlin wecken. Auch 2026 wird das Festival die Spielzeit in der Hauptstadt mit seinem unverwechselbaren Glanz eröffnen. Der Termin steht bereits fest: vom 28. August bis 23. September 2026. Das Programm erscheint im April 2026.
INFORMATIONEN
Einige Konzerte des Musikfest Berlin 2025 sind digital in der Mediathek der Berliner Festspiele abrufbar.
Kontakt zur Autorin: Svetlana.Alexeeva@digital-insight.de
2025-10-01


BOTSCHAFTER IN BERLIN
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen über die ausländischen Botschaften in Berlin von A wie Afghanistan bis Z wie Zypern. Schauen Sie doch mal rein unter www.botschafter-berlin.de.
MONATSBRIEF
Wenn Sie sich für unseren kostenlosen Monatsbrief anmelden möchten, senden Sie bitte eine Nachricht.
LESER ÜBER UNS
Impressum | Datenschutzerklärung
© Diplomat Media Berlin 2017 —